In einem einzelnen linearen Metall-Ligand-System kann die
Wechselwirkung vom ![]() -,
-, ![]() - oder
- oder ![]() -Typ sein, wie
Abb. 1 zeigt. Dieses Bild setzt allerdings voraus, da"s
Metall-d- und Ligandenorbitale in entsprechender Weise zueinander
orientiert sind. Bei Verwendung orthoaxial ausgerichteter Orbitale
ist dies gleichbedeutend mit der Forderung, da"s die lokalen
Koordinatensysteme des Zentralatoms und des Liganden eine gemeinsame
z-Achse haben und da"s die x- und y-Achsen jeweils parallel
zueinander sind. Im Allgemeinen ist dies jedoch nicht der Fall (Abb.
2 links). Man hat jedoch innerhalb des entarteten
d-Satzes eine Basistransformation "`frei"', so da"s man durch
Drehungen des Metallkoordinatensystems um drei Winkel
-Typ sein, wie
Abb. 1 zeigt. Dieses Bild setzt allerdings voraus, da"s
Metall-d- und Ligandenorbitale in entsprechender Weise zueinander
orientiert sind. Bei Verwendung orthoaxial ausgerichteter Orbitale
ist dies gleichbedeutend mit der Forderung, da"s die lokalen
Koordinatensysteme des Zentralatoms und des Liganden eine gemeinsame
z-Achse haben und da"s die x- und y-Achsen jeweils parallel
zueinander sind. Im Allgemeinen ist dies jedoch nicht der Fall (Abb.
2 links). Man hat jedoch innerhalb des entarteten
d-Satzes eine Basistransformation "`frei"', so da"s man durch
Drehungen des Metallkoordinatensystems um drei Winkel ![]() ,
,
![]() und
und ![]() (Euler-Winkel) die oben beschriebene
Standardorientierung immer erreichen kann. Die einzelnen Schritte
sind in Abb. 2 gezeigt: Drehungen um
(Euler-Winkel) die oben beschriebene
Standardorientierung immer erreichen kann. Die einzelnen Schritte
sind in Abb. 2 gezeigt: Drehungen um ![]() und
und ![]() (die Winkel sind mit den Polarkoordinaten des Liganden identisch)
f"uhren zur Koinzidenz der z-Achsen, die abschlie"sende Drehung um
(die Winkel sind mit den Polarkoordinaten des Liganden identisch)
f"uhren zur Koinzidenz der z-Achsen, die abschlie"sende Drehung um
![]() richtet die x- und y-Achsen parallel aus. Die
richtet die x- und y-Achsen parallel aus. Die
![]() -Drehung ist nur bei Liganden mit anisotroper
-Drehung ist nur bei Liganden mit anisotroper ![]() -
Wechselwirkung (
-
Wechselwirkung ( ![]() erforderlich - zum
Beispiel beim H_2O-Molek"ul, das nur ein
erforderlich - zum
Beispiel beim H_2O-Molek"ul, das nur ein ![]() -st"andiges
lone pair hat.
-st"andiges
lone pair hat.
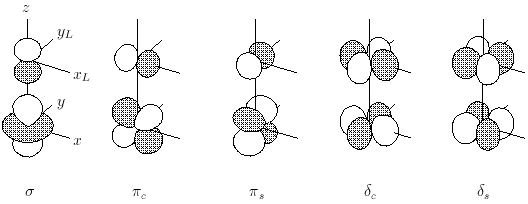
Figure 1:
Symmetrie der Metall-Ligand-Wechselwirkungen
Figure 2:
Drehung des Metallkoordinatensystems um drei Euler-Winkel
Der mit den Drehungen verbundenen Koordinatentransformation entspricht
eine Zerlegung der d-Orbitale in Symmetriekomponenten bez"uglich des
neuen Koordinatensystems. Die alten Orbitale ![]() sind
mit den neuen, im gedrehten System symmetrieadaptierten Orbitalen
sind
mit den neuen, im gedrehten System symmetrieadaptierten Orbitalen
![]() "uber eine orthogonale
Transformation
"uber eine orthogonale
Transformation ![]() verkn"upft:
verkn"upft:
flambda